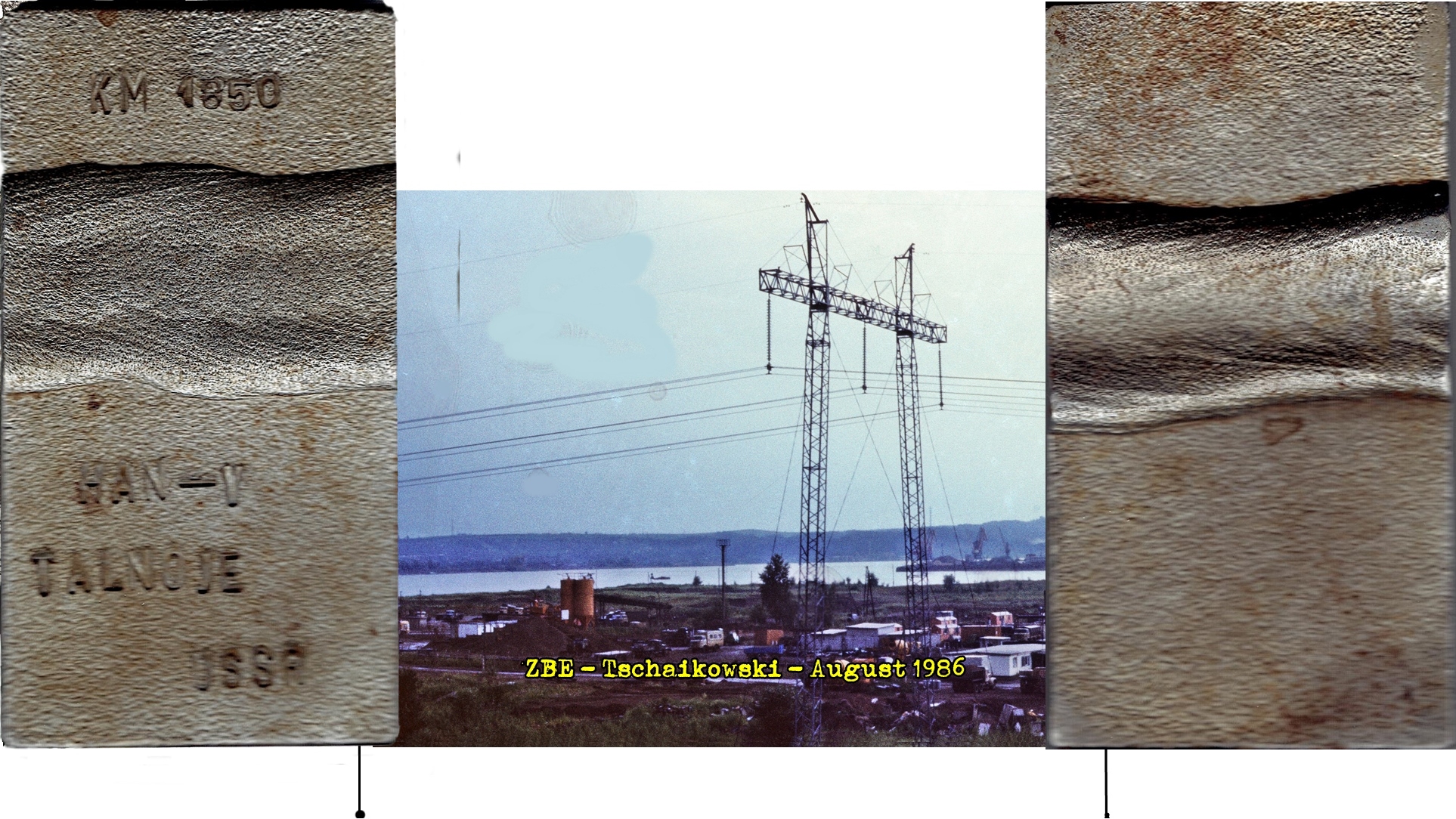
Berlin, Hauptstadt der DDR, 27.Oktober 1989
Theo Kappner schmiss die »Berliner Zeitung« wütend auf die Couch. »Es ist doch scheißegal, ob du die »Berliner« oder das »ND« liest. Wie schon immer steht in den Wurstblättern der gleiche Müll. Und das im altgewohnten Tonfall. Mann oh Mann! Wie lange wollen die sich noch derart präsentieren?«
In einen Bademantel gehüllt kam Lisa Kappner aus dem Bad ins Wohnzimmer. Sie nahm Theos Bierflasche vom Tisch und trank daraus einen Schluck. Lächelnd stellte sie die Flasche zurück und verschränkte die Arme unterm fülligen Busen. »Ich hab‘ dich gehört, Kappner. Du schreist ja laut genug. Aber wieso glaubst du, das die Journaille sich ändert? Nur, weil gestern in Dresden Hunderttausende durch die Straßen gezogen sind? Und diesmal nicht, wie vor zwanzig Tagen auf sie eingeprügelt wurde? Oder der Krenz mit Kohl in –konstruktiver Atmosphäre– telefoniert hat? Ich konnte die Zeitung nämlich vorhin auch lesen, bevor du sie dir eingekrallt hast. Darum gebe ich dir sogar Recht! Die lassen sich immer noch viel lieber über die 12. Tagung vom FDJ-Zentralrat aus. Denn dabei können sie auf die altgewohnten Formulierungen zurückgreifen. Und schwätzen zudem darüber, dass sich der Ministerrat Gedanken bereitet, wie bessere Waren in die Läden gelangen. Aber bei dem was das Land wirklich bewegt kommen sie ins Schwimmen.«
Kappner trank die Flasche leer. Er stellte sie neben den Sessel auf den Teppich, wobei sein Blick auf Lisa ruhte. Plötzlich überzog ein anzügliches Lächeln sein Gesicht.
»Was grinst du so spitz?«, gurrte seine Frau.
Er deutete wortlos nach unten, wo sich ihr Bademantel einen Spaltbreit geöffnet hatte.
»Na und?« Sie lachte leise. »Schwarze Strümpfe eben. Aus dem Exquisit! Und – ich bin frisch gebadet!«
»Uiiii! Das qualifiziert unseren Freitagabend aber gewaltig! Denn genau das brauche ich, wenn die mir schon das Wochenende versaut haben!« Kappner erhob sich rasch aus dem Sessel. »Gehe ich richtig in der Annahme, junge Frau, dass jetzt gevö …!« Mitten im Satz unterbrach er sich und lauschte ebenso wie Lisa.
Ihrer beider Aufmerksamkeit richtete sich auf die Wand zur Nachbarwohnung. Nur schwer zu überhören ertönte von nebenan das laute Geschrei des Nachbarn. Unterbrochen wurde es immer wieder vom aufheulenden Geflenne der Nachbarin. Dazwischen plärrten die beiden Kleinen.
Nachdem sie beide einen Augenblick gelauscht hatten, schüttelte Kappner den Kopf. »Scheiß dünne Wände in der Platte!« Fragend schaute er seine Frau an. »Ist der nur besoffen, oder haut der gerade die Isolde zusammen?«
»Der Balzer und –schlagen?« Lisa postierte sich auf der Sessellehne. Solcherart, dass ihr nunmehr freiliegender rechter Schenkel gut mit dem Strumpfsaum kontrastierte. Sie klang skeptisch. »Der ist doch beim Magistrat. Dazu noch altbewährter Genosse und Hausbuchführer!«
»Na und? Wieso sollte der seine Olle nicht verdreschen? Wie ’ne moralische Instanz hat der sich, wie ich ihn kenne noch nie aufgeführt. Oder?«
»Ich zieh‘ mir schnell was an«, entgegnete Lisa und sprang auf. »Wenn die Brüllerei nicht aufhört, geh ich rüber!« Sie verschwand im Schlafzimmer.
Kappner schaute ihr kurz hinterher, knurrte unwillig und schlurfte zur Wohnungstür.
Gerade als er die Hand auf die Klinke legte, drangen Geräusche durch die dünne Hartfaserplatte aus dem Treppenhaus herein. Die Tür der Nachbarwohnung wurde lautstark aufgeschlossen und krachte drüben im Wohnungsflur gegen die Wand.
Er öffnete rasch, trat einen Schritt nach vorn hielt aber im Türrahmen inne.
Sein Nachbar, Balzer, stand auf dem Treppenabsatz vor dem Fahrstuhl. In der Linken trug er einen Koffer. Mit der Rechten drückte er hektisch den Rufknopf des Lifts.
In der offenen Tür zur Nachbarwohnung lehnte Isolde Balzer. Von ihrer Stirn rann Blut mit Tränen vermischt übers angstvoll verzerrte Gesicht.
Die kleinen Mädchen zerrten am Hosenbein ihrer Mutter. Jetzt fast schon stimmlos und mit Rotzfahnen, die aus den Näschen liefen.
»Das hast du dir selbst zuzuschreiben!«, brüllte Balzer mit einem Blick auf seine Frau und hieb mit der Faust wie wild gegen die Fahrstuhltür. »Ich hab dir gesagt, dass ihr mit mir kommt. Die nehmen uns alle auf!« Er stieß ein irres Kichern aus. »Aber du? Du entdeckst plötzlich deine Sesshaftigkeit! Scheiße! Wer von uns beiden wollte denn immer in die Alpen?« Er öffnete die Fahrstuhltüren, sprang in den Korb und hackte auf der Tastatur herum.
Durch das kleine Fenster erwischte Kappner noch einen letzten Blick auf den cholerischen Nachbarn. Dann verschwand der Lift in die Tiefe.
Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte er plötzlich eine Bewegung. Auf dem abwärtigen Treppenabsatz standen die Wollmanns aus der Neunten. Konsterniert wirkend starrten sie zu ihm empor. »Keine Panik, Leute! Hier oben ist erst mal Sendpause!«, sagte er mit einer beruhigenden Handbewegung. »Wir kümmern uns um den Rest der Familie. Also besten Dank für eure Anteilnahme!«
Unterdessen hatte Lisa, sie trug jetzt einen Jogginganzug, die Nachbarin in ihren Arm geschlossen. »Komm, Isolde, wir gehen rein. Ich guck mir mal deinen Kopf an. Du blutest ja wie ’n Schwein!« Mit der freien Hand drängte sie die Gören vor sich her, in den Flur hinein. »Schließ bei uns ab, Theo, der Schlüssel steckt!«, sagte sie über die Schulter. »Und dann komm hier herein.«
Kappner folgte den Anweisungen seiner Frau. Daraufhin schaute er, ob die Wollmanns abgetaucht waren. Dafür ging eine halbe Treppe hinab.
Vom Flurfenster aus entdeckte er Balzer unten auf dem Parkplatz. Der warf soeben den Koffer in seinen »Dacia«, der neben Kappners »Wartburg« stand. Nach einem flüchtigen Blick nach oben schwang er sich in seinen Wagen und verschwand damit in der Dunkelheit.
Kopfschüttelnd stieg Kappner die Stufen empor und betrat die Nachbarwohnung. Bereits im Flur sah es aus wie nach einer Hausdurchsuchung. Balzer hatte wahrlich alles durchwühlt, um die Koffer zu füllen. Von denen noch zwei neben der Küche standen.
Lisa verband soeben Isoldes Kopf, als Kappner das Wohnzimmer betrat.
In ihrer Spielecke hockten eng aneinander gekuschelt die beiden Mädchen. Auch hier worden die Schubladen und Schranktüren geöffnet.
Auf dem Fernseher lief die Tagesschau, der Ton kaum hörbar. So bekam Kappner gerade noch das Wort »Generalamnestie« mit.
»Sie will nicht zum Arzt!«, sagte Lisa an ihren Mann gewandt. »Es sind auch nur zwei kleine Platzwunden. Die hat sie sich dort an der Schrankecke geholt. Hab sie verpflastert. Für die Veilchen an beiden Augen kann sie sich nur mit Kühlung behelfen. Da muss das Arschgesicht ganz schön zugehauen haben!« Sie deutete mit dem Kopf zur Zimmertür. »Hol mal bitte einen kalten Waschlappen aus dem Bad!«
Dort stellte Kappner auf einen Blick fest, das alle Utensilien für den Mann auf der Konsole fehlten. Er kühlte einen bunten Waschfleck mit Wasser, das er lange laufen lassen musste.
Zurück im Wohnzimmer setzte er sich neben die Nachbarin und drückte ihr den kalten Lappen in die Hand. »Sag an, Isolde! Was war los bei euch? Wieso knallt dein Alter so durch und macht sich im Finsteren alleine vom Acker?«
Statt einer Antwort deutete sie, den Fleck ans rechte Auge gepresst, hinüber zu einem Schrankwandteil. »Lisa, bitte sei lieb. Dort drin stehen der Schnaps und auch die Gläser.«
Lisa erhob sich, holte eine Flasche »Goldkrone« und zwei Schnapsgläser aus dem Schrank. »Kannst gerne mit Theo einen trinken. Ich bleib dabei außen vor!«, sagte sie und füllte die Gläser.
Isolde stieß mit Kappner an. Sie trank und zog die Nase hoch. »Verdammt hat der zugehauen«, murmelte sie und verzog das Gesicht.
»Also los!«, bellte er. »Was für eine Schau hat dein Alter abgezogen? Oder willst du, dass wir die Polizei holen?«
Sie schüttelte den Kopf und stöhnte leise. »Nee, nee! Lass'‘ man. Die Vopos brauchen wir nicht. Ist halt ‘ne normale Familienangelegenheit!«
Lisa, die derweil die beiden Mädchen nebenan im Kinderzimmer auf ihre Betten gelegt hatte, kam wenig später zurück. »Hab‘ ich richtig gehört? Eine Familienangelegenheit? Also gut. Dann sag uns, was Sache ist. Oder sollen wir gleich wieder gehen?«
Isolde seufzte und hob abwehrend die Hände. »Nee, nee! Bitte bleibt hier. Ich durfte ja bisher mit keinem darüber quatschen.« Sie nahm dankbar das Taschentuch, das Lisa ihr reichte, und putzte sich die Nase. Daraufhin fing sie an, ihr Herz auszuschütten. »Schon vorn paar Monaten als unsere Leute in Ungarn und Österreich übern Zaun stiegen, begann er mich zu nerven. Wir müssten jetzt auch mitmachen! Heutzutage wäre es möglich, wo doch so viele abhauen! Sagte er. Ich aber sah immer diese Bilder vor mir. Ich meine die Unmengen Menschen mit den kleinen Kindern in Prag in der Botschaft! Nee hab ich zu ihm gesagt. Das tue ich unseren Mädels nicht an. Und wieso willst du weg? Hab ich gefragt. Hast den gut bezahlten Posten beim Magistrat, bist Genosse und Hausbuchführer! Wie passt das denn zusammen? Mit dem abhauen nach dem Westen?« Sie goss sich noch einen Schnaps ein und trank ihn in einem Zug. Kappners ablehnende Geste nahm sie mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. »Na ja. Kurze Zeit gab er Ruhe. Ich dachte schon, es wäre für ihn gegessen. Aber heute hatte er gehört, dass sie alle Leute über die CSSR rauslassen wollen. Wegen »Generalamnestie« oder wie das heißt. Da ist er nachmittags plötzlich früher heimgekommen und fing sofort an die Koffer zu packen. Auch für mich und die Kinder. »Wir fahren noch heute Abend! Keine Diskussion mehr!«, hat er gesagt. Ich hab‘ mich gesträubt, die Mädels in ihrem Zimmer eingeschlossen. Da begann er zu schreien und nach mir zu schlagen. Ich hab‘ zurückgebrüllt. Da verpasste er mir die Veilchen. So ging’s ’ne Weile hin und her. »Na gut, dann fahre ich eben alleine! Ich schick‘ dir ne Karte. Aus den Alpen!«, sagte er plötzlich ganz zynisch. Er schnappte sich seine Koffer und wollte zur Tür. Ich ihm hinterher. Bin bloß gegen den blöden Schrank geknallt. Und den Rest kennt Ihr ja. Da stand der Theo draußen in der Tür und mein Alter haute ab!«
Isolde nahm dankbar den dritten Schnaps, den Lisa ihr einschenkte, und kippte auch ihn auf Ex.
»Was können wir sonst noch für dich machen?«, fragte Kappner höflich.
Isolde zuckte mit den Schultern. »Nichts! Ich kann mich nur bei euch bedanken. Muss halt warten, ob der Balzer sich mal meldet. Wenn er‘s denn in seinen gelobten Westen schafft!« Sie reichte beiden die Hand und brachte sie zur Tür.
Zurück in ihren vier Wänden stieß Lisa hörbar den Atem aus. Sie deutete mit dem Daumen nach nebenan. »Heute kein Wort mehr darüber, Kappner!«
Er winkte ab. »Nee, danke! Ich hab’ genug anderes im Kopf. Wie ich es dir vorhin schon sagen wollte, bevor bei Isolde der Knatsch losging. Der Sonnabend ist zumindest für mich flöten gegangen. Dabei ist es eigentlich gar nicht mein Ding! Trotzdem muss ich morgen bei der Inventur mitmachen. Obwohl ich in dieser Scheiß-Betriebsküche nur als Koch bezahlt werde!« Zerknirscht schüttelte er den Kopf. »Irgendwie hat es wohl einer in der Betriebsleitung mitbekommen, dass ich davon auch ’ne Ahnung habe. Und nur weil sich zwei Kollegen angeblich über die CSSR in den Westen abgesetzt haben, greifen sie mich jetzt bei den Eiern!«
»So ’n Mist!«, maulte Lisa. »Da geht ja das ganze Wochenende flöten! Wollten wir eigentlich nicht in die Sternwarte fahren?« Plötzlich lächelte sie, ihre Augen blitzten. »Das, mit den Eiern, überlass mal besser mir!« Sie pflückte sich hastig den Jogginganzug vom Leibe. Darunter war sie nackt, trug nur die schwarzen, halterlosen Strümpfe. Dann legte sie den Kopf etwas schräg. »Ich bin zwar bissel verschwitzt wegen der ganzen Bambule. Doch ich hoffe, dass du mich auch so nimmst!«
»Weib! Ich liebe es, wenn du dich so gibst!«, rief Kappner freudestrahlend und zerrte sich die Klamotten vom Leibe.«
Schwerin (Anfang Januar 1990)
Der Anruf aus der Hauptabteilung erreichte Hauptmann Frank Bauerfeind am späten Nachmittag.
Oberst Führmann teilte ihm in knappen Worten mit, dass er am nächsten Tag zur Mittagszeit in Berlin anzutreten habe.
Erleichtert, weil die lange Wartezeit zu Ende war, legte Bauerfeind den Hörer auf.
Er ging nach nebenan ins Bad. Einem plötzlichen Drang nachgebend stellte er sich vors Toilettenbecken und urinierte. Er spülte. Während des Händewaschens betrachtete er sich im Spiegel mit dem grünen Plasterahmen.
Habe ich etwa zugenommen wegen des langen Herumgegammele? Diese Frage schoss ihm durch den Kopf, derweil er sich eingehend musterte. Er strich sich übers kurz geschnittene, dunkle Haar, kratzte das stoppelige Kinn. Nachdenklich betrachtete er die breiten Schultern, den kräftigen Nacken, der aus dem offenen Kragen ragte. Das Hemd spannte jedoch nur ein klein wenig überm Bauch. Eingeschränkter Alkoholgenuss und morgens etwas längere Gymnastik würden das Problem beseitigen.
Mit diesem Vorsatz kehrte er zurück ins Wohnzimmer, stellte sich dort ans Fenster. Die schwarzen, kahlen Straßenbäume streckten sich in den dunklen Januarhimmel. Am Rande der grauen, löchrigen Pflasterstraße standen einige Autos. Schummeriges, gelbliches Licht spendend beleuchtete linker Hand eine Straßenlaterne den alten »Moskwitsch« des Nachbarn.
Er setzte sich in den Sessel gegenüber dem ausgeschalteten Fernseher. Aus der Flasche, die auf dem Couchtisch stand, goss er einen Schnaps in das bunte Gläschen. Er trank und gab sich seinen Gedanken hin.
Zum Ende September ließ man ihn befehlsgemäß seinen Delegierungsvertrag mit dem BMK beenden. Seitdem saß er daheim in Schwerin in seiner Wohnung herum. Zur Untätigkeit verdammt wartete er auf einen Anruf aus dem Ministerium.
Die vergangenen drei Jahre hatte er bis zu seiner Rückdelegierung die »Aktualisierer« für den Bauabschnitt Ukraine eingearbeitet. Wobei er die letzten Monate nur noch routinemäßige Kontrollen ausführte.
In den langen Wochen, während er tatenlos in seiner Heimatstadt herumlungerte, bemerkte er unvermittelt bestimmte Dinge. Die um ihn herum passierten, ihn zunehmend beunruhigten, die ihm Kopfzerbrechen bereiteten. Auch, weil er sie zuvor anscheinend nicht wahrnehmen wollte.
Jetzt jedoch nach seiner Rückkehr in die Heimat vermochte er nicht mehr länger negieren, was in der Republik vor sich ging. Das alles erfüllte ihn mit Besorgnis, zumal man sich vonseiten der HVA bedeckt hielt.
Die vergangenen fünf Jahre, die er vorrangig in der Ukraine verbrachte, verursachten persönliche Folgen. Er verfügte nicht mehr über alten Bekanntschaften oder gar Freunde. Der Versuch Frank Althaus, seinen früheren Mitstreiter aus der Bezirksstelle, telefonisch zu erreichen schlug ebenfalls fehl.
So verbrachte er die meisten Tage mit Lesen. Zumal sich das Fernsehen als höchst unerquicklich erwies. Auf dem Gerät, das er vor langer Zeit seiner Mutter schenkte, vermochte er nur die beiden DFF-Programme in Farbe zu sehen. Doch die Meldungen wurden hüben wie drüben zunehmend beängstigender. Unerklärliches schien sich anzubahnen.
Einmal die Woche kaufte er am nahe gelegenen Bahnhofkiosk eine Flasche »Nordhäuser«. Um sich mit der Hälfte ihres Inhaltes am Nachmittag zu betrinken. Zuvor kramte er ein altes Pornoheft aus einer verborgenen Lade, an dessen Herkunft er sich nicht mehr erinnern konnte. Indem er den Schnaps genoss, starrte er auf die bunten Abbildungen und masturbierte.
Seine Mutter, die nach dem Tode des Bruders vor drei Jahren immer mehr gesundheitlich abgebaut hatte, verstarb Anfang Achtundachtzig. Bis zu Letzt kam sie ebenso wie er selbst mit den Umständen nicht ins Reine, die zum Ableben von Marco führten.
Seitdem nutzte er jede Möglichkeit, um an Informationen über seinem Bruder zu gelangen. Was auch immer dessen Arbeit und sein damaliges Umfeld im Ural betraf, versuchte er zu eruieren. Doch so, wie er es hörte, hatte man Marcos ehemalige Brigade inzwischen aufgelöst. Die Kumpels wurden auf neue Trassenabschnitte verteilt oder beendeten ihre Verträge
Zudem verfügte er nicht mehr über direkte Kontakte zu den beiden anderen OibE, Bruhns und Schneider.
Denn nach dem Abschluss der Installationen auf den Baustellen kamen die gemeinsamen Dienstrapporte im Ministerium in Wegfall. Seitdem befahl man sie, jeden allein, zum Rapport nach Berlin.
Daher vermochte er auch nicht Kolja Bruhns befragen, wie er es ursprünglich plante. Der war, fortgesetzt, für den Bauabschnitt Ural zuständig. Somit besaß der wohl am ehesten die gesuchten Informationen.
Währenddessen Bauerfeind am Bildschirm Zeuge wurde wie die Mauer fiel, verspürte er tief in sich eine eigentümliche Leere.
Nun ist es also soweit, dachte er. Von jetzt an, nach dem Westen offen wie ein Scheunentor, kann die Republik nicht mehr auf die gleiche Art weiterexistieren. So, wie in den vergangenen vierzig Jahren wird es nicht funktionieren!
Doch auch in Anbetracht der Ungewissheit was kommen könnte, empfand er keinerlei Beklemmungen oder sogar Panik wie andere. Stattdessen gelangte er zu einer neuen Sicht auf die Dinge, die ihn selbst überraschte.
Jene Kräfte, die schon lange eine Veränderung im Lande forderten, zeigten sich anscheinend befähigt, das Heft in die Hand zu nehmen. Und nicht zuletzt tönten die Stimmen der Politiker aus der BRD unüberhörbar herüber. Damit zeichnete sich wohl bereits die veränderte Marschrichtung ab, der man jetzt folgen würde.
Er selbst hegte noch nie die allgemein verordneten Vorbehalte gegen den Westen. Auch, wenn das seinen dienstlichen Verpflichtungen strikt entgegen stand. Den politischen Überzeugungen, die man gemäß seiner Arbeit für das Ministerium von ihm erwartete, kam er nur nach außen hin nach.
Dem verpönten Kapitalismus hatte er jedoch den realen Sozialismus als Lebensraum stets vorgezogen.
Zu dieser Haltung bewogen ihn vor allen dessen offensichtliche und immer wieder bezeugte Vorzüge. Wie die soziale Absicherung, Arbeit für alle und die unermüdlich bekundete Friedensliebe in der DDR.
Dessen ungeachtet hatte er sich, während der knapp zwei Jahre die er sich in Frankreich im Einsatz befunden hatte, im Kapitalismus ausgesprochen wohlgefühlt. War auch die Gefahr der Entdeckung dauernd gegenwärtig, so entlohnten dafür gewisse Freiheiten.
Denn nicht nur auf Paris beschränkte sich damals sein Wirkungsfeld. Seine Zielpersonen kontaktierte er zudem in Lyon, in Orleans und in Chamonix. Dabei vermittelte ihm diese Mission genügend Erfahrungen, wie man im kapitalistischen Frankreich gut zu leben vermochte.
Am vergangenen Weihnachtsabend hatte er allein in der Wohnung vor dem alten Fernseher gehockt. Missmutig verfolgte er das westlich aufgemotzte Programm, gönnte sich nur einen Glühwein. Zu Silvester ging er bereits eine Stunde vor Mitternacht ins Bett.
Mit Renate traf er sich nach seiner Rückkehr aus der Ukraine Anfang Oktober nur einmal. Obwohl er sich auf sie freute, verbrachten sie nur eine gemeinsame Nacht, die für beide Seiten zudem recht unbefriedigend endete. Sie gaben sich redliche Mühe miteinander. Ihre Gedanken kreisten jedoch um wichtigere Dinge, als sich dem anderen völlig hinzugeben.
Gleich nach dem Mauerfall verschwand Renate sofort in Richtung Westen. Bisher kehrte sie noch nicht zurück.
Er nutzte die freie Zeit und fuhr zum Jahresende über die offene Grenze nach Hamburg. Nur, um sich mal in der Hafenstadt umzusehen. Dabei vermied er sogar, etwas vom Begrüßungsgeld auszugeben. Das tat er nicht etwa aus Geiz. Er wusste einfach nicht, wofür er das rare Westgeld aus dem Fenster werfen sollte.
Jetzt schrieb man schon das Jahr Neunzig und heute kam der erwartete Anruf. Aus den knappen Worten von Oberst Führmann schloss er, dass man ihn mit einer wichtigen Aufgabe betrauen wollte. Auch mit einer längeren Abwesenheit von Schwerin wäre zu rechnen.
Der Hals hatte sich ihm zugeschnürt, als er den Hörer nach seiner Bestätigung auflegte.
Was soll ich tun? Wie verhalte ich mich jetzt? Diese Frage spukte ihm zuvor bereits mehrfach durch den Kopf. Vor allem, wenn er im Fernsehen die schockierenden Berichte über die umsturzähnlichen Veränderungen im Lande betrachtete, drängte sie sich ihm auf. Demzufolge schien es ihm, dass die politische Lage bald noch chaotischer werden würde. Nicht nur, dass die Mauer fiel. Man trug sie in scheinbar hektischer Eile vielerorts schon ab.
Neue Regierungen kamen und gingen. Die gesellschaftlichen Organisationen – einfach aufgelöst. Selbst das Ministerium blieb davon nicht verschont! Die Umwandlung in ein sogenanntes »Amt für Nationale Sicherheit« hatte man bereits vorgenommen. Damit gab es, weil man diesen Dienst inzwischen wieder schrittweise zur Gänze abschaffen musste, das »Ministerium« im Grunde genommen gar nicht mehr.
Die Frage, wie lange die Zentrale im Gebäude in der Normannenstraße in Berlin überhaupt noch bestünde, schwebte unbeantwortet im Raum. Die meisten Bezirksverwaltungen in der Republik wurden ohnehin bereits erstürmt oder chaotisch aufgelöst.
In Anbetracht dessen lag der Gedanke an das Ende nahe. Nach den dramatischen Veränderungen in den letzten Wochen ging alles anscheinend in Richtung Selbstauflösung.
Er raufte sich die Haare. Dann suchte er sich zu beruhigen, goss noch einen Korn ins Glas.
Jetzt musste er die Entscheidung treffen! Seine kindisch anmutende Hoffnung, dass man ihn im Ministerium unter Umständen vergessen habe, galt mit dem Telefonat als hinfällig. Aber, wenn er nicht auf den Ruf aus Berlin wie erwartet reagierte, bedeutete das – Fahnenflucht!
Verdammt, diese beschissene Verpflichtung! Den Eid hatte er damals voller Überzeugung geleistet. In der Gewissheit den Guten anzugehören. Doch da schien er wohl einem Trugschluss unterlegen zu sein.
Zumindest ließ ihn das ein Zwiespalt vermuten, in den er in letzter Zeit zunehmend geraten war.
Beim Rückblick auf zum Teil unsägliche Dinge, die in den vergangenen Jahren auch durch sein Mittun geschehen waren, fühlte er zunehmende Skrupel. Und stellte sich die Integrität des Dienstes dadurch nicht selbst infrage?
Eine Flucht nach dem Westen, als Alternative zur Rückkehr nach Berlin? Diese Frage schwärte voller Ungewissheiten in ihm. Er kannte die Bundesrepublik nicht, käme als Bettler. Nur geschätzte dreitausend Mark lagen auf seinem Sparbuch. Nicht viel, für einen Zuwanderer. Zudem mit seiner Vergangenheit!
Ungeachtet seiner Zweifel packte Bauerfeind in einem Akt verzweifelter Entschlossenheit am Abend das »kleine Marschgepäck«. Neben einigen Kleidungsstücken und dem Waschzeug stopfte er in den Campingbeutel alle seine Papiere.
Auch die aus dem geheimen Versteck.
Die Ungewissheit, wann und ob er überhaupt hierher zurückkehren würde, erschien ihm zu groß!
Am darauf folgenden Morgen, als er aufbrach, herrschte draußen noch Dunkelheit. Zuvor löschte er im Kachelofen die Glut und drehte den Gashahn zu. Nach einem letzten, prüfenden Rundgang durch die Wohnung schloss er die Tür ab.
Ein eisiger Nieselregen fiel. Ohne den Blick zu wenden, marschierte er über schlecht beleuchtete Fußwege zum Bahnhof.
Berlin, Hauptstadt der DDR (6. Januar 1990)
Die Stadt präsentierte sich kalt und schneefrei. Es regnete nicht, wie zuvor noch in Schwerin. Gelegentlich drängte sich die Sonne für einen kurzen Augenblick durch die Wolkendecke.
In der Halle des Lichtenberger Bahnhofs schaute sich Frank Bauerfeind aufmerksam um. Plötzlich entdeckte er einen alten Bekannten.
Kolja Bruhns, der »OibE für den Ural«, stand inmitten von umherhastenden Reisenden. Über der Schulter trug er einen Campingbeutel. Soeben blickte er nach oben zu der großen Anzeigetafel.
Bruhns hatte sich nicht verändert. Stämmig, das dunkle Haar kurz geschnitten sah er aus wie eh und je. Doch in der Menge wirkte er ein bisschen verloren.
Vorsichtig trat Bauerfeind von hinten an ihn heran. »Wartest du zufälligerweise auf mich?«, raunte er und tippte ihm auf den breiten Rücken.
Bruhns fuhr herum, überrascht riss er die Augen auf. Nach kurzem Zögern drückte er Bauerfeinds Hand. »Haben sie dich auch hergeholt?«, fragte er leise und schaute dabei rasch in die Runde.
Sein Gegenüber nickte. »Weißt du, was wir hier machen sollen? Der Oberst klang am Telefon so – konspirativ! «, entgegnete er gedämpft.
Bruhns hob kurz die Schultern, schüttelte daraufhin den Kopf. »Ich hab’ keine Ahnung, worum es geht!«, sagte er nach einem Blick auf seine Armbanduhr. »Aber uns bleibt noch Zeit. Los! Wir setzen uns nach oben, in diese »Tagesbar«. Da können wir reden«
Sie stiegen über die breite Treppe hoch zur Empore und gingen durch die linker Hand gelegene Eingangstür in die Bar. Dort platzierten sie sich selbst an einen der Tische am Ende der langen Fensterfront. Von hier aus konnte man fast die ganze Bahnhofshalle überblicken.
Sie ließen sich in die Sessel fallen. Aufmerksam schauten sie sich im Gastraum um. Nur eine Handvoll Gäste hockten, in der Nähe des Bartresens, in den schwelgenden Polstern.
»Derzeit scheint jeder sein Geld krampfhaft festzuhalten. Um möglichst wenig davon auszugeben«, sagte Bruhns leise.
»Was bei den Preisen, die sie von uns für die vielen, neuen Waren aus dem Westen kassieren wollen auch kein Wunder ist!« Bauerfeind klang knurrig, wobei er durch die Glasfront in die Halle hinabdeutete.
Dort auf den freien Flächen sowie an den Eingängen herrschte Gedränge. Zumeist schwarzhaarige Händler hatten auf Tapeziertischen ihre Artikel ausgebreitet.
Auf sich durchbiegenden Sperrholzplatten bot man bunte, illustrierte Zeitschriften und Tageszeitungen aus dem Westen an. Ebenso Bananen, Orangen. Auch anderes Obst, das man bisher im Osten nur selten oder noch gar nicht kaufen konnte.
Bruhns schüttelte den Kopf und verzog angewidert das Gesicht. »Mann! Wenn ich diesen bunten Schund sehe, den sie uns jetzt überall andrehen wollen, wird mir schlecht! Wo soll das denn nur hinführen?« Er brannte sich eine Zigarette an, nachdem Bauerfeind die ihm entgegen gestreckte Schachtel dankend abgelehnt hatte. »Ich durfte seit Oktober letzten Jahres daheim hocken«, sagte er. »Nur herumgesessen habe ich. Und mir angeschaut, wie sie uns nach und nach platt machen!« Harsch winkte er ab, pustete den Rauch zur Seite. »Doch jetzt mal zu dir, Frank! Wo hast du bis heute gesteckt?«
Bauerfeind setzte zu einer Antwort an.
Da jedoch schlurfte eine Serviererin, mittleren Alters, an den Tisch heran. Mit einem mürrischen Gesichtsausdruck fragte sie nach ihren Wünschen. Dabei fingerte sie einen Kellnerblock aus ihrer weinroten, offenen Weste, aus der eine üppig gefüllte, weiße Bluse quoll.
»Ich hätte gern ein Kännchen Kaffee«, sagte Bauerfeind im verbindlichen Tonfall.
Ihr Blick irrte hinab in die Bahnhofshalle. »Kännchen is’ nicht. Gibt’s nicht mehr. War einmal. Entweder ’n Pott oder ’ne Tasse!«, lautete die flapsige Antwort.
Bauerfeind entschied sich kopfschüttelnd für den Pott. Bruhns schloss sich dem an.
»Seit Ende September habe ich daheim herumgesessen, genau wie du. Durfte auf den Anruf warten«, nahm Bauerfeind das Gespräch erneut auf, nachdem sich die Servierkraft hinwegbewegt hatte. »Was glaubst du denn, was sie mit uns vorhaben? Jetzt, wo nacheinander die Bezirksverwaltungen ausgeräumt wurden? Ich jedenfalls sehe für diese »Zentrale« kaum ’ne Chancen für ‘n Weiterbestehen. Du etwa?«
Bruhns schüttelte nachdenklich den Kopf. Er drückte die Kippe in einem Aschbecher aus, der einen bunten Werbeaufdruck trug. »Ich vermute mal, wir sollen dort bei irgendwas helfen. Wohl, um zu retten, was zu retten ist. Aber warten wir’s ab. Schließlich befinden wir uns immer noch im aktiven Dienst! Darum ist dein Pessimismus eventuell fehl am Platz!«
Weil die Serviererin soeben mit dem Kaffee an den Tisch zurückkam, wurden die Männer für einen Moment abgelenkt. Wortlos servierte sie die Bestellung, um sich daraufhin langsam wieder in Richtung Büfett zu entfernen.
Bruhns starrte lächelnd auf ihr eindrucksvolles Hinterteil und die strammen Waden.
Bauerfeind, der dies bemerkte, hob die Brauen. »Stehst du auf den Typ Frau? Dicke Titten und breiten Arsch?«
Ein schiefes Grinsen überflog Bruhns Gesicht. Dann schnupperte er an seinem dampfenden Pott. »Der Kaffee ist auch schon aus dem Westen. »Mocca-Fix« ist das hier nicht!«, knurrte er.
Bauerfeind nahm eine bunte, gelackte Angebotskarte vom Tisch. Auf ihr prangte groß der Firmenname eines Bremer Kaffeerösters. Mit der Karte deutete er auf den gleichen Schriftzug, der gleichermaßen die Kaffeepötte zierte. »Die Westfirmen können sich offensichtlich ratzfatz bei uns einkaufen. Ich nehme an, das betrifft nicht nur die Gastronomie! Wird wohl bald mit allen anderen Dingen auch so sein.«
Schweigend tranken sie ihren Kaffee.
Bis sich Bauerfeind laut räusperte. Einem aufblitzenden Gedanken folgend tippte er sein Gegenüber mit dem Finger an. »Sag’ mal, Kolja! Wir konnten uns ja seit Sechsundachtzig nicht mehr persönlich treffen. Wie war das noch? Bist du damals nicht auch in Prokowski im Einsatz gewesen?«
Bruhns warf ihm einen misstrauischen Blick zu. Nach kurzem Zögern nickte er zustimmend. »Ja, – das war ich. Warum fragst du?«
Jetzt nutzte Bauerfeind die Gelegenheit, auf die er so lange gewartet hatte. »Erinnerst du dich eventuell an einen Vorgang, der um die Faschingszeit Sechsundachtzig herum passierte? Ich meine, als in eurem Wohnlager ein junger Maschinist vom –Linearen Teil– zu Tode gekommen ist?« Bruhns riss überrascht die Augen auf. »Fasching? Im Jahre Sechsundachtzig? Mann, oh Mann, – da musste ich mich mit anderen Sachen beschäftigen! Das weiß ich noch. Ein Toter beim LT sagst du?« Er schüttelte den Kopf. Einen langen Augenblick schien er nachzudenken, wobei er hinab in die Bahnhofshalle starrte. Bauerfeind wollte ihn soeben erneut ansprechen, als Bruhns aufschaute. »LT? Ja, mir fällt ’s wieder ein. Da hatte sich ein junger Kollege erhängt. Dass jedenfalls galt als die offizielle Version. Ich kann’ mich noch erinnern, weil es an Fasching passierte.« Einen Moment stockte er. »Aber warum interessiert dich das?«, fragte er, wobei er den Kopf etwas zur Seite neigte. Ein misstrauischer Unterton schwang in seiner Stimme mit. Seine Finger zitterten leicht, als er die Kippe im Ascher austupfte.
Bauerfeind, der dies nicht bemerkte, legte ihm rasch die Hand auf den Unterarm. Er drückte heftig zu, sein Gesicht rötete sich.
Bruhns wich zurück, soweit es die Sessellehne zuließ. Die Augen zu schmalen Schlitzen verengt starrte er sein Gegenüber an.
»Weil der, der sich damals erhängte, mein kleiner Bruder gewesen ist! «, zischte Bauerfeind.
Bruhns registriert erleichtert, dass sich der Griff lockerte und die Hand von seinem Arm glitt.
Beide schwiegen eine Weile. Aus der Halle drangen halblaut die Zugansagen herein. Von oben, von der Decke her, ertönte leise Musik.
Schließlich stieß Bruhns hörbar den Atem aus, fuhr sich mit den Fingern durchs kurze Haar. »Mann, so eine Scheiße aber auch! Das – war dein Bruder?«
Bauerfeind nickte bedeutungsvoll und beugte sich zu ihm hin. »Los Kolja! Erzähl’ mir, was du darüber weißt!«
Bruhns nahm hastig einen Schluck Kaffee, brannte sich danach eine weitere »Semper« an. »Ich weiß eigentlich davon nicht viel. Weil für mich, entschuldige bitte, zu dieser Zeit das alles nicht von Belang gewesen ist «, entgegnete er und zuckte die Schultern. »Mich beschäftigten damals ganz andere Dinge!« Er zog an der Zigarette, blies den Rauch zur Decke. »Also gut. Man sagte, der Junge hätte sich zuerst besoffen und späterhin aufgehängt. Angeblich aus Heimweh. Zum Erhängen nahm er wohl einen Trassenschal. Einen von diesen blauen Wollschals meine ich. Die kennst du doch?«
Bauerfeind schüttelte unwirsch den Kopf. »Nein, in der Ukraine gab’s die nicht. Aber rede schon! Was weißt du ansonsten noch von der Sache?«
Bruhns pustete wieder den Rauch zur Decke und fixierte daraufhin sein Gegenüber. »Nun ja. Im Wohnlager kursierte damals seit längerer Zeit irgendeine Scheißhausparole. Dass der Chef von der DSF auch eine Aktie dran gehabt hätte. Der wäre wohl schwul gewesen. Hat sich angeblich an den Jungen rangemacht!« Er hob mit einer abwehrenden Geste die Hand, weil Bauerfeind die Augen überrascht aufriss. »Aber, wie gesagt, das waren alles nur Gerüchte. Die konnte oder wollte keiner belegen. Obwohl ich noch eines weiß! Der Fettsack von der DSF verschwand ein paar Wochen später vom Bauabschnitt. Quasi über Nacht! Kurz danach ist ein neuer eingereist. Mit Ehefrau. Der hat von da ab den DSF-Dödel gegeben.« Er trank von seinem Kaffee. Nach einem raschen Blick auf die anderen Gäste sprach er leise weiter. »Monate nach dieser Sache hab‘ ich mal mit dem Sicherheitsinspektor von der Baustelle, dem Frank Faber, einen zur Brust genommen. Dabei kam er von sich aus auf dieses Thema zu sprechen. Der Faber hatte damals angeblich zusammen mit dem Doc die Tatortfotos ausgewertet. Die soll in seinem Auftrag der Chef von den Versorgern geknipst und entwickelt haben. Beim genaueren Hinsehen entdeckten sie zufällig, dass der Junge wohl auch einen Schlag ins Genick bekam. Faber vermutete daraufhin, dass es mit dem Schal nur eine Art Ablenkung gewesen wäre. Das wurde bloß dahin gehend nie offiziell untersucht, sagte er. Danach hätte sich ohnehin keiner mehr dafür interessiert. Da passierten ganz andere Sachen, die alle viel stärker beschäftigten. Übrigens fällt mir da noch etwas ein. Der Doktor Langner, der Baustellenarzt, verschwand kurz darauf. Angeblich haute er im Urlaub nach dem Westen ab, munkelte man. Aber mehr weiß ich auch nicht, Frank. Da bin ich mir sicher. Tut mir leid um deinen Bruder.«
Bauerfeind winkte ab. »Danke! Kannst du dich an den Namen von dem Macker von der DSF erinnern? Und ist es möglich, dass der meinen Bruder ...?«
Bruhns nickte. »Ja, das wäre denkbar. Habe später so was auch von anderer Seite gehört. Und der Name? Ja, das war ’ne echt blöde Sache. – Knäblein – hieß der. Entschuldige bitte. Doch das stimmt wirklich. War so ein dicker, schwammiger Typ.«
Schweigend vor sich hinstarrend trank Bauerfeind seinen Kaffee in kleinen Schlucken aus. Alles was sein Gegenüber ihm soeben berichtete bestätigte seine Vermutung.
Marco konnte sich nicht selbst erhängt haben!
Ein angeblich möglicher Schlag in den Nacken? Verdammt! Wurde da etwas vertuscht? Die Sache stank gewaltig nach einem – Mord!
Von wegen er hätte sich betrunken! Marco rührte niemals einen Tropfen Alkohol an! Auch nicht an der Trasse!
Rasch stieg vor Bauerfeinds inneren Auge eine Erinnerung auf.
Es begab sich bei einer familiären Zusammenkunft daheim, als der Kleine zum ersten Mal aus dem Ural in den Urlaub kam. Da beschwerte er sich darüber, dass man ihn anfangs in seiner Brigade wegen seiner Abstinenz schräg anschaute, ja sogar verhöhnte!
Doch letztendlich hätte man sich daran gewöhnt, dass er jederzeit nüchtern blieb. Während sich seine Kollegen stets hackedicht abfüllten, sorgte er für Ordnung, schlichtete Streit.
Bauerfeind zeigte sich immer fest in der Überzeugung, dass Marco damals, als es passierte, auf keinen Fall betrunken war.
Und die Sache mit dem Schwul sein?
Nun, das stand auf einem anderen Blatt! Leider. Denn hierbei schien so etwas, wie eine Art von Veranlagung, vonseiten ihres Vaters bei den Kleinen durchgeschlagen zu sein.
Schon, als Marco sich in der Pubertät befand, erkannte er dessen Wesenszug. Er versuchte, ihm zu helfen. Das tat er, indem er dem Jungen ans Herz legte, seine Gefühle und Neigung nicht zu unterdrücken. Gib dich so, wie du bist, forderte er ihn auf.
Aber er bekam dessen ungeachtet mit, dass sein Bruder in der Öffentlichkeit immer betont männlich auftreten wollte. Niemals bekannte er sich zu seinem Schwul sein. Stattdessen kaschierte er es.
Daraus resultierte wohl auch Marcos Entschluss, an die Trasse zu gehen. Doch damit nicht genug! Letztlich verpflichtete sich der Junge zur angeblich härtesten Truppe, dem LT!
Doch aus Bruhns Schilderungen heraus ließ sich auf vieles schließen.
Auf irgendeine Weise geriet Marco anscheinend in die Finger dieses homosexuellen Funktionärs von der DSF. Woraufhin er unter seltsamen Umständen zu Tode kam.
Und das alles soll ein Selbstmord gewesen sein?
Bauerfeind zwang sich zur Ruhe.
Denn jetzt wusste er einiges mehr, was ihm weiterhelfen würde. Doch darum vermochte er sich erst später kümmern. Heute wollte er sich nur noch die Namen notieren, die ihm Bruhns soeben genannt hatte. Vielleicht kam ihnen eines Tages eine Bedeutung zu!
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen.
»Geht’s dir gut, ist alles in Ordnung?«, fragte Bruhns argwöhnisch. Dabei warf er einen Blick auf seine Uhr.
Bauerfeind schob den Kaffeepott beiseite und nickte beherzt. »Ja! Mir geht nur nach dem, was du mir erzählt hast, einiges durch den Kopf. «
Bruhns winkte der Serviererin zu.
Sie zahlten, verließen die Tagesbar und strebten der U-Bahn zu. Jetzt galt es erst einmal abzuklären, was es mit dem Ruf ins Ministerium auf sich hatte.
 Print
Print
 RSS
RSS

